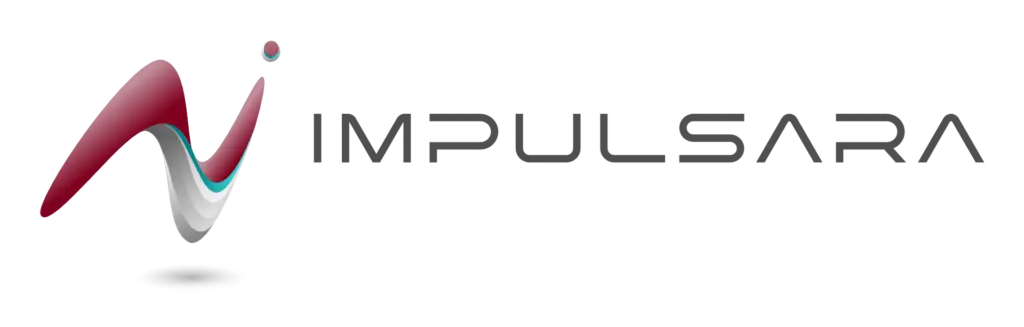von Bastian Splonskowski
Warum scheitern so viele Strategien?
Viele Strategien scheitern nicht an fehlenden oder guten Ideen, sondern daran, dass sie nicht wirksam werden. Die klassische Strategiearbeit mit langfristigen Plänen und Zielvorgaben stößt in einer zunehmend komplexen und dynamischen Welt an ihre Grenzen. Aus dem systemischen Beratungsansatz können wir einige Aspekte für die Strategieentwicklung übernehmen, um sie lebendiger und adaptiver zu gestalten.
Die Gründe für das Scheitern von Strategievorhaben sind vielfältig, exemplarisch folgen ein paar Beispiele:
- Wenn Strategien auf einem zu abstrakten Level erarbeitet werden, erreichen sie die operative Realität nicht und bleiben ein Papiertiger.
- Fühlen sich Mitarbeitende bei der Strategieentwicklung nicht eingebunden, werden Initiativen für strategische Klarheit schnell kraftlos und verlaufen im Sande.
- Wenn Führungskräfte und Teams unterschiedliche Bilder davon haben, was die Strategie bedeutet und wie sie in der Operativen umgesetzt wird, entsteht Verwirrung statt Klarheit.
- Die zunehmende Komplexität und Veränderung machen starre Pläne schnell obsolet
Laut einer Studie des Beratungsunternehmens BCG aus dem Jahr 2024 verfehlen 70 % der Strategievorhaben ihr Ziel. Strategien werden dann für die sprichwörtliche Schublade erarbeitet.
Systemische Strategieentwicklung: ein lebendiger Ansatz
Um Strategien robuster gegenüber den oben genannten Faktoren zu machen, kann die systemische Strategieentwicklung hilfreich sein.
Hierbei wird eine Strategie nicht als konkreter, starrer Plan begriffen, sondern in immer neuen Zyklen iterativ gedacht. Dafür ist es wichtig, dass Phasen der Unsicherheit akzeptiert wird. Sicherheit entsteht immer wieder neu, wenn die Organisation Vertrauen in die eigene Lern- und Entwicklungsfähigkeit hat und dieses im Rahmen der Strategieentwicklung einsetzt. Neben Zielvorgaben stehen dabei der Sinn einer Unternehmung oder einer Abteilung im Zentrum der Betrachtung. Der amerikanische Unternehmensberater Simon Sinek nennt diesen Sinn das „Why“ einer Organisation.
Warum Beteiligung entscheidend ist
Eine weiteres Erfolgskriterium für Strategien ist die Art ihrer Erarbeitung. Erfolgreiche Strategien werden nicht von außen (oder hierarchisch von oben) verordnet, sondern gemeinsam entwickelt. Dabei ist die Beteiligung möglichst vieler Perspektiven entscheidend, um anschlussfähige Konzepte zu entwickeln: Wenn ich weiß, dass meine Kollegin am Entstehungsprozess beteiligt war, kann ich die Strategie eher annehmen, als wenn ich sie von meinem Chef vorgesetzt bekomme. Wichtige Perspektiven zu integrieren bedeutet übrigens nicht automatisch, dass die gesamte Belegschaft an aufwendigen Prozessen teilhat. Partizipation kennt viele Möglichkeiten, die auch Effizienz und Produktivität im Unternehmen im Blick behalten können.
Um die Perspektiven zusammenzubringen, ist Kommunikation entscheidend – statt direktiven Vorgaben steht der Dialog im Vordergrund. Wie in der systemischen Beratung werden Spannungen und Widerstände genutzt und nicht wegmoderiert.
Hypothesen statt Gewissheiten
So verstandene Strategieentwicklung bleibt spannend, denn die ausgearbeitete Strategie wird nicht als perfekt angesehen wird. Vielmehr werden im Prozess Hypothesen über erfolgversprechende Entwicklungsrichtungen gebildet, die anschließend bewusst ausprobiert und bei Bedarf angepasst werden. Strategiearbeit kann dadurch dynamisch und experimentell werden, was die Attraktivität und die Motivation zur Beteiligung erhöht.
Die veränderte Rolle von Berater:innen
Die Rolle von Beratern ändert sich dadurch wesentlich. Sie gehen nicht als „Strategieberater“ mit hoher Expertise in die Entwicklung, sondern als Facilitatoren: Sie regen Suchbewegungen an, ermöglichen Reflexionsschleifen, machen auf Muster aufmerksam und schaffen Räume, in denen diese Themen diskutiert werden können. Solche Prozesse nehmen mehr Zeit in Anspruch, als die von oben vorgegebene Strategie. Außerdem ist die Strategieentwicklung nur möglich, wenn die Mitarbeitenden genügend Motivation mitbringen, um sich in diesen Prozess zu begeben.
Allerdings gilt bei einem so verstandenen Strategieprozess: der Weg ist bereits das Ziel. Denn die bewusst und moderierte Beschäftigung mit der wünschenswerten Zukunft im Unternehmen erzeugt bereits Mehrwert für alle Beteiligten. Die Vorteile überwiegen vor allem dann, wenn die Erarbeitung einer Strategie ernst gemeint ist und nicht dazu dient, sie nach außen hin zu vermarkten.
Rudolf Wimmer & Reinhart Nagel stellen in ihrem Buch „Systemische Strategieentwicklung“ einige praktische Formate vor, mit Hilfe derer nachhaltige Strategien erarbeitet werden können:
- Strategielabore schaffen den Raum für Suchbewegungen und das Aufstellen von Hypothesen
- Purpose-Sprints können Organisationen dabei helfen, Sinn und Kern der Unternehmung zu erfassen
- Zukunftskonferenzen können eine Vielzahl an Perspektiven zusammenbinden, die über ihre jeweiligen Bilder von der Strategie verhandeln
- Hypothesenbasierte Roadmaps, um die Strategie in die Praxis umzusetzen – konzipiert inkl. Rückmelde- und Reflexionsschleifen