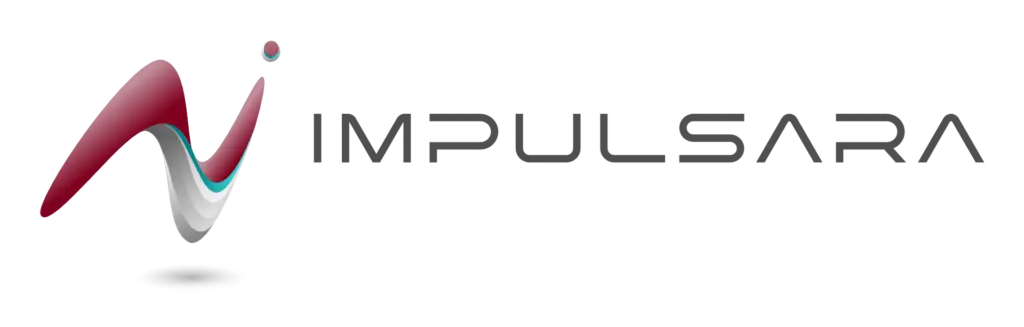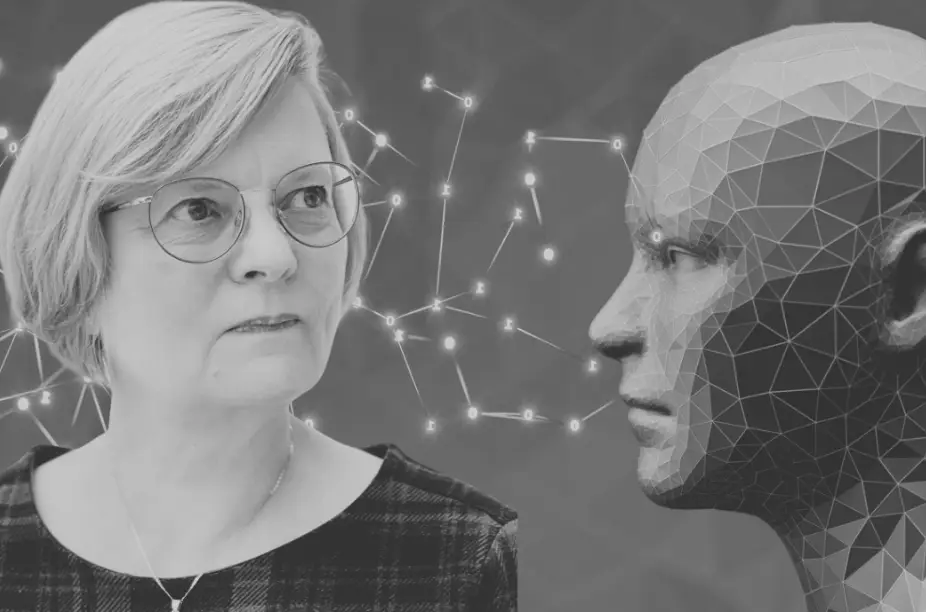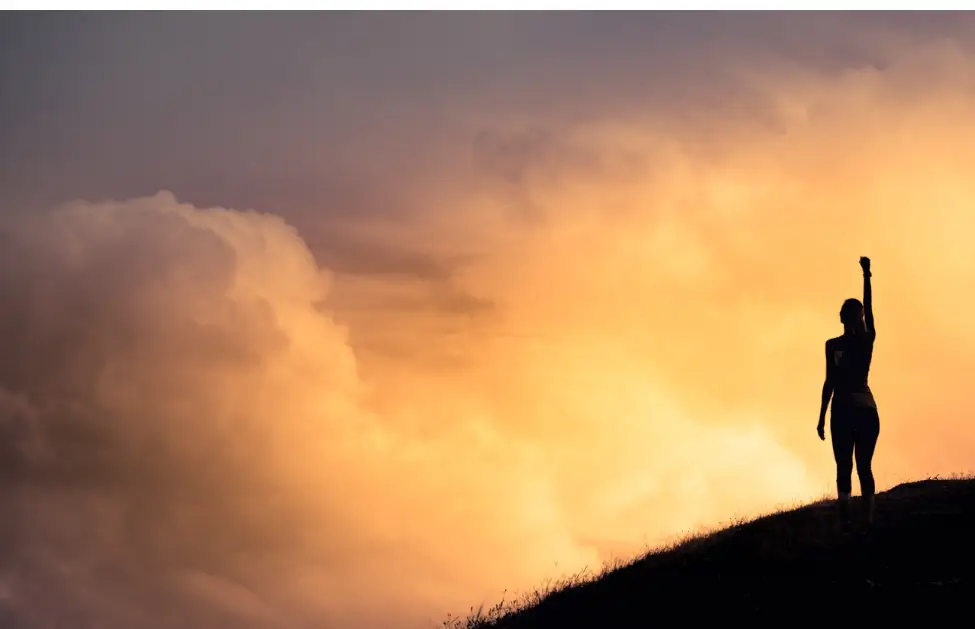Entscheidungen im Spannungsfeld von Bewusstsein und Unbewusstem: Wie viel Kontrolle haben wir wirklich?
Nachdem es in den letzten drei IMPULSARA-Newslettern um das Thema Confirmation Bias (Bestätigungsfehler) ging [1], möchte ich heute eine grundlegendere Frage aufwerfen: Wie frei sind wir eigentlich in unseren Entscheidungen?
Das Konzept der Biases legt nahe, dass kognitive Verzerrungen Muster in unserem Denken formen, die unseren Entscheidungsprozess in alltäglichen Situationen prägen. Doch wie weit reicht dieser Einfluss? Sind wir diesen Mustern ausgeliefert? Könnte es sogar sein, dass unbewusste Prozesse die Hoheit über unser Handeln haben?
Diese Fragen sind nicht nur für die Neurowissenschaft von Interesse, sondern berühren auch unser grundlegendes Menschenbild. Haben wir einen freien Willen – oder werden unsere Entscheidungen unbewusst für uns getroffen?
Benjamin Libets Experiment: Der erste Zweifel am freien Willen
Vor rund 50 Jahren schien die Neurowissenschaft eine Antwort gefunden zu haben. Der Forscher Benjamin Libet führte in den 1980er Jahren ein Experiment durch, das bis heute kontrovers diskutiert wird.[2]
Sein Versuchsaufbau war simpel: Versuchspersonen sollten spontan eine Handbewegung ausführen und dabei den Zeitpunkt notieren, an dem sie sich bewusst dazu entschieden. Gleichzeitig wurde die Hirnaktivität per EEG gemessen.
Das überraschende Ergebnis: Bereits eine halbe Sekunde vor der bewussten Entscheidung zeigte das Gehirn eine Aktivierung – die sogenannte Bereitschaftspotenzialaktivität. Es schien also, als ob das Gehirn bereits wusste, was zu tun ist, bevor die Versuchsperson sich bewusst dafür entschied.
Die Schlussfolgerung, die Libet daraus zog, war weitreichend: Der Mensch wird von unbewussten oder vorbewussten Entscheidungen gesteuert, die erst später bewusst wahrgenommen werden. In letzter Konsequenz würde das bedeuten, dass es keinen freien Willen gibt – unsere Entscheidungen wären nur nachträgliche Rationalisierungen eines bereits getroffenen Entschlusses.
Diese Interpretation ist nicht nur wissenschaftlich brisant, sondern hat auch praktische Implikationen: Wenn unser Unbewusstes tatsächlich alle Entscheidungen trifft, wie viel Kontrolle haben wir dann über unser eigenes Handeln? Und wie steht es um unsere Verantwortung für unsere Entscheidungen – sei es im privaten oder im beruflichen Umfeld?
50 Jahre später: Was sagt die moderne Neurowissenschaft?
Im Oktober 2024 war ich zu Gast auf der Kortizes-Konferenz[3], auf der führende Neurowissenschaftler aktuelle Erkenntnisse über das Verhältnis von Bewusstem und Unbewusstem präsentierten. Besonders gespannt war ich darauf, wie die Fachwelt 50 Jahre nach Libet diese Fragen beantwortet.
Eine meiner zentralen Erkenntnisse der Konferenz war: Trotz enormer Fortschritte in der Hirnforschung wissen wir noch immer erstaunlich wenig darüber, wie unser Gehirn tatsächlich funktioniert. Ein grundlegendes Problem in der Neurowissenschaft ist die methodische Herangehensweise: Naturwissenschaftliche Experimente benötigen Versuchsaufbauten, die Messungen ermöglichen. Doch genau hier liegt die Herausforderung – das Gehirn ist ein hochkomplexes System, das sich nicht einfach in monokausale Ursache-Wirkungs-Beziehungen fassen lässt.
Jostein Gaarder hat einmal in seinem Roma Sofies Welt gesagt: „Wenn das Gehirn des Menschen so einfach wäre, dass wir es verstehen könnten, dann wären wir so dumm, dass wir es doch nicht verstehen würden.“ In unserem Gehirn gibt es vielfache Wechselwirkungen, die mit neurobiologischen Versuchsanordnungen immer nur in Ausschnitten abgebildet werden können. Das schmälert in keiner Weise die Arbeit und die Erfolge in dieser Wissenschaft, setzt sie jedoch in das richtige Licht.
Das bedeutet auch, dass das Libet-Experiment in einem neuen Licht betrachtet werden muss. Prof. John-Dylan Haynes[4] brachte es in seinem Vortrag auf der Kortizes-Konferenz auf den Punkt: Das Verhältnis zwischen Bewusstem und Unbewusstem ist keine simple Dominokette, bei der ein Reiz automatisch eine festgelegte Reaktion auslöst. Stattdessen gibt es komplexe Rückkopplungsmechanismen, die Entscheidungen beeinflussen, verändern oder sogar verhindern können.
Die moderne Neurowissenschaft ist sich einig: Das Unbewusste spielt eine zentrale Rolle, aber es steuert uns nicht vollständig.
Neuroplastizität: Das Gehirn als dynamisches System
Ein weiterer entscheidender Punkt ist die Erkenntnis, dass unser Gehirn hochgradig vernetzt und anpassungsfähig ist. Bereits im 19. Jahrhundert erkannte der Neurowissenschaftler Paul Broca, dass verschiedene Areale des Gehirns unterschiedliche Funktionen übernehmen. Doch heute wissen wir, dass diese Areale nicht starr voneinander getrennt arbeiten. Inzwischen wissen wir, dass unser Gehirn in der Lage ist, Defizite auszugleichen indem sich Areale „unterstützen“. Unser Gehirn arbeitet hochgradig vernetzt. Das Stichwort hierfür lautet Neuroplastizität[5]. Das bezeichnet die Fähigkeit des Gehirns, sich lebenslang zu verändern und anzupassen, indem Nervenzellen neue Verbindungen bilden oder bestehende stärken. Dieser Prozess ermöglicht Lernen, Anpassung an neue Situationen und sogar Erholung nach Verletzungen.
Das Gedächtnis speichert Erfahrungen, Routinen und Kompetenzen in verschiedenen Bereichen des Gehirns – vordergründig im Hippocampus, langfristig in verteilten Netzwerken der Großhirnrinde. Doch bewusstes Denken und Entscheiden erfolgt im präfrontalen Cortex.
Prof. Ulrich Ansorge[6] erklärte auf der Kortizes-Konferenz das Zusammenspiel dieser Prozesse anhand des Begriffs der Absicht:
Das Bewusstsein reflektiert, kontrolliert und setzt Ziele. Es arbeitet absichtsvoll.
Das Unbewusste verarbeitet Informationen und stellt Ressourcen bereit, aber es arbeitet absichtsabhängig – es formt nur selten selbst eine Absicht.
Dieses Zusammenspiel bedeutet: Unser Unbewusstes ist keine autonome Entscheidungsinstanz, sondern eine Unterstützung für das bewusste Handeln.
Es ist also nicht so, dass unser Unterbewusstes (und damit auch diverse Bias) uns automatisch steuern, sondern vielmehr kann man sagen, unser Bewusstsein ist absichtsgebend und fordert vom Unbewussten die erforderlichen „Zuarbeiten“ an. Bildhaft können wir uns unser Bewusstsein als Kapitän auf der (bewussten) Schiffsbrücke vorstellen, der je nach Absicht und Kurs seines Handelns auf die Ressourcen zurückgreift, die unter Deck im (unbewussten) Schiffsrumpf zur Verfügung stehen.
Fazit: Kontrollverlust oder Entscheidungsfreiheit?
Die moderne Neurowissenschaft zeigt, dass wir nicht bloß Spielbälle unseres Unbewussten sind. Wir treffen Entscheidungen nicht entweder bewusst oder unbewusst – sondern in einem dynamischen Zusammenspiel aus beidem.
Die entscheidende Frage ist also nicht, ob unser Unbewusstes Einfluss auf uns hat – sondern wie wir diesen Einfluss bewusst nutzen können. Selbstverständlich sollten wir uns der effizienzgetriebenen Mechanismen unseres Gehirns bewusst sein und nicht vergessen, dass unser Gehirn versucht, ressourcenschonend unsere Entscheidungen zu unterstützen und zu vereinfachen. Das bedeutet jedoch nicht, dass unser Unbewusstes im Autopilot über uns entscheiden kann. Kompetenzen wie Reflexion, Zielbildung, Feedback, Diskurs und ähnliche kommunikative Kompetenzen dabei, die Regie zu übernehmen beim Zugriff auf unsere erworbenen Kompetenzen. In unserer IMPULSARA Serie über die kognitiven Verzerrungen haben wir herausgearbeitet, wie wir uns bewusst mit den Risiken aus Verzerrungen umgehen. Hier kannst Du diese Artikel noch einmal nachlesen.
Und warum es so schwerfällt, wirklich objektiv zu entscheiden, zeigen wir im Beitrag „Bestätigungsfehler: Wie du Dein Team schützt“.
[1] https://impulsara.de/2025/03/04/confirmation-bias-1/
[2] https://de.wikipedia.org/wiki/Libet-Experiment
[4] https://www.informationphilosopher.com/solutions/scientists/haynes/